Bakterien in Trinkwasserinstallation

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und enthält immer Mikroorganismen. Während die meisten harmlos sind, können bestimmte Keime wie Legionellen oder coliforme Bakterien ein Gesundheitsrisiko darstellen. Deshalb unterliegt Trinkwasser strengen Kontrollen. Entscheidend sind mikrobiologische Parameter und Indikatorparameter, die die Wasserqualität bewerten und mögliche Gefahren frühzeitig erkennen lassen.
Mikrobiologische Parameter und Indikatorparameter
Koloniezahl bei 22 °C (Indikatorparameter)
Der Parameter Koloniezahl bei 22 °C zeigt aufgrund der Wachstumstemperatur überwiegend Mikroorganismen aus der Umwelt an. Erhöhte Koloniezahlen können auf Verunreinigungen des Trinkwassers nach der Aufbereitung und/oder im Verteilungsnetz bis zur Trinkwasserinstallation hinweisen (z. B. mangelhafte Wirksamkeit der Aufbereitung/Desinfektion, zeit- und materialabhängige Einflüsse der Trinkwasserverteilung, Havarien, Rohrbrüche, überflutete Wasserversorgungsanlagen, Stagnation des Trinkwassers im Verteilungssystem). Auch Eingriffe in die Trinkwasserinstallation bei Neu- oder Umbauten können zu erhöhten Koloniezahlen führen.
Koloniezahl bei 36 °C (Indikatorparameter)
Neben der Zustandsinformation und den Kontaminationsursachen analog zur Koloniezahl bei 22 °C ist aufgrund des Wachstums bei Körpertemperatur des Menschen bei erhöhten Koloniezahlen bei 36 °C in der Trinkwasserinstallation das Vorkommen potenziell pathogener Mikroorganismen (z. B. Pseudomonas aeruginosa, Legionella spec.) noch stärker zu berücksichtigen.

Mikrobiologische Belastung
des Trinkwassers
Indikatorparameter und potenzielle
Gefahren durch Bakterien
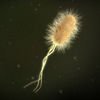
Escherichia coli oder Intestinale Enterokokken
Escherichia coli oder intestinale Enterokokken können eine Trinkwasserinstallation kontaminieren, sich dort aber nicht weiter vermehren, im Gegensatz zu Legionellen oder Pseudomonas aeruginosa. Nachgewiesene E. coli oder Enterokokken sind ein eindeutiger Hinweis auf fäkale Einträge. Wenn Enterokokken nachgewiesen werden, muss immer mit dem Vorkommen anderer fäkal ausgeschiedener Erreger gerechnet werden. Ihr alleiniger Nachweis ist wegen ihrer hohen Persistenz ein Indiz für eine länger zurückliegende Kontamination. Wenn E. coli allein oder zusammen mit Enterokokken nachgewiesen werden, ist eher von einer frischen Verunreinigung auszugehen.
-
Ursachen der Verunreinigung
Eine Kontamination von Trinkwasserinstallationen mit Escherichia coli oder Enterokokken deutet auf fäkale Einträge hin und erfolgt meist durch das Einspeisen kontaminierten Wassers aus der öffentlichen oder zentralen Trinkwasserversorgung. Ursachen können schadhafte Versorgungsleitungen oder Hochwasserschäden sein. Zudem kann eine unzulässige Verbindung der Trinkwasserinstallation mit Nicht-Trinkwasseranlagen, etwa bei Betriebswasser oder Dachablaufwasser, zur Verunreinigung führen. Eine weitere potenzielle Quelle ist unsauberes Arbeiten an der Trinkwasserinstallation, beispielsweise bei Umbau- oder Instandsetzungsmaßnahmen.
Coliforme Bakterien (Indikatorparameter)
Coliforme Bakterien umfassen verschiedene Arten von Umwelt- und Fäkalbakterien. Im Gegensatz zu E. coli und Enterokokken hat ihr Vorkommen im Trinkwasser nicht zwangsläufig eine fäkale Ursache, sondern kann auch durch unspezifische Kontaminationen des Trinkwassers (z. B. Schmutzeinträge) verursacht sein. Niedrige Konzentrationen bedeuten nicht zwingend einen Eintrag von außen. Denn es genügt, wenn die Fließgeschwindigkeit des Wassers plötzlich erhöht wird oder die Fließrichtung umgekehrt wird. Schon können coliforme Bakterien aus vorhandenen Ablagerungen oder Biofilmen mobilisiert werden.
Eine Vermehrung von coliformen Bakterien im Leitungssystem ist zu erwarten, wenn ungeeignete Leitungsmaterialien eingesetzt werden, die Nährstoffe ins Wasser abgeben, die Wassertemperatur über 20 °C beträgt und/oder anaerobe Bedingungen herrschen.
Viele coliforme Bakterien zählen zu den fakultativen Krankheitserregern, die insbesondere für immungeschwächte Patienten in medizinischen Einrichtungen Bedeutung haben können. Bei bestimmten Grunderkrankungen können Infektionen mit coliformen Keimen (z. B. Enterobacter und Klebsiellen) zu ernsten Komplikationen führen.


Clostridium perfringens (Indikatorparameter)
Clostridium perfringens sind gram-positive, unbewegliche, stäbchenförmige, anaerobe Bakterien. Sie produzieren Endosporen, die gegenüber Hitze, pH-Extremen, UV-Licht und Desinfektionsverfahren wie z. B. Chlorung oder Ozonung überaus resistent sind. Sie kommen im Darm von Menschen und Tieren vor und gehören dort zur normalen Darmflora. Außerhalb des Darmes überleben die Bakterien teilweise sehr lange, hauptsächlich in Form ihrer resistenten Sporen (z. B. in Boden, Staub und Wasser).
Die sehr hohe Resistenz und Persistenz soll ein Hinweis für das Vorkommen der ebenfalls resistenten und persistenten Sporen von fäkalbürtigen Parasiten sein. Er kann ebenso als Indikator für den Nachweis der Effizienz der Desinfektion und der physikalischen Entfernung von Viren und Protozoen genutzt werden.
Clostridium perfringens sind bei der Erst- und Wiederinbetriebnahme eines Trinkwassernetzes zu untersuchen. Eine Untersuchungspflicht im Rahmen der routinemäßigen Untersuchungen besteht nur für Wasser, das von Oberflächenwasser stammt oder von diesem beeinflusst wird. (TrinkwV § 29 und Anlage 3, Teil 1)
Legionellen (spezieller Indikatorparameter nach TrinkwV Anlage 3, Teil 2)
Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die natürlicherweise in geringer Zahl in Oberflächengewässern, Grundwasser und anderer ausreichend feuchter Umwelt (z.B. Kompost und feuchter Erde) vorkommen. Sie zählen zu den Auslösern von umweltbedingten Infektionen bei Menschen. Es sind mehr als 60 Arten und 79 Serogruppen bekannt. Das RKI schätzt alle als potenziell krankheitserregend ein. Ihr bevorzugter Lebensraum ist erwärmtes, stagnierendes Wasser (z. B. in Leitungen und Speichern).
Unter diesen ungünstigen Bedingungen können sie sich auf ein unzulässiges Maß vermehren, was zum Erreichen oder Überschreiten des Technischen Maßnahmenwertes führen kann. Eine nennenswerte Vermehrung von Legionellen tritt üblicherweise nur bei Wassertemperaturen zwischen 25 und 45 °C auf. Deshalb werden vorwiegend nur Warmwasserproben auf Legionellen untersucht. Wird im Kaltwasser an Entnahmestellen eine Temperatur von über 25 °C festgestellt, müssen auch diese nach UBA-Empfehlung beprobt werden.
Legionellen kommen meist mit dem vom Wasserversorger gelieferten Trinkwasser in die Trinkwasserinstallation eines Gebäudes, jedoch in sehr niedrigen Konzentrationen.
Legionellen stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Eine Übertragung auf den Menschen kann durch Einatmen erregerhaltiger Aerosole, aber auch durch Aspiration (Eindringen von erregerhaltigem Trinkwasser in die Luftröhre oder Lunge) erfolgen. Zu unterscheiden sind eine schwere, atypische Lungenentzündung mit oft tödlichem Ausgang und ein nicht behandlungsbedürftiger, grippeähnlicher Verlauf, das Pontiac-Fieber. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht bekannt. Generell haben Menschen mit geschwächtem Immunsystem ein höheres Erkrankungsrisiko. Dazu zählen vor allem ältere Menschen, bei denen häufig Vorschädigungen oder spezifische Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus vorliegen. Diese Risikogruppe wird aufgrund der demographischen Entwicklung in Zukunft noch zunehmen.
Ebenfalls stark gefährdet sind Personen unter immunsuppressiver Therapie oder mit chronischen Lungenerkrankungen. Die Meldeinzidenz liegt bei 1,8 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner (Quelle: RKI Jahrbuch 2022 ). Da nicht alle Pneumonien auf eine Legionelleninfektion getestet werden, ist von einer deutlichen Untererfassung auszugehen. Die tatsächliche Inzidenz der nicht-krankenhausassoziierten Fälle der Legionärskrankheit wird anhand von Studieninformationen auf etwa 18 bis 36 Fälle pro 100.000 Einwohner geschätzt.
Zusätzlich erkranken 10 bis 100 mal mehr Menschen am Pontiac-Fieber. Der Erkrankungsgipfel liegt in den Sommer- und Herbstmonaten. Als Ursache werden allgemein höhere Wassertemperaturen, die das Wachstum der Legionellen begünstigen, sowie feuchtwarme Witterung angesehen.
Legionellen kommen natürlicherweise im Wasser vor, unabhängig von äußeren Belastungen. Sie gelten als Indikatoren für den hygienisch-technischen Betriebszustand einer Trinkwasserinstallation. Wird der technische Maßnahmenwert erreicht oder überschritten, deutet das darauf hin, dass bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb oder der Wartung der Anlage die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) möglicherweise nicht eingehalten wurden – was das Wachstum von Legionellen begünstigen kann.
?$100$)

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa zählt zu den potenziellen Krankheitserregern, die verbreitet in der Umwelt, insbesondere in feuchten Böden, Pfützen und Gewässern vorkommen. Daher findet dieses Bakterium auch in technischen Systemen wie der Trinkwasserinstallation einen geeigneten Lebensraum.
Bei deutlicher Vermehrung geben Pseudomonas aeruginosa einen Hinweis auf mögliche Stagnationsprobleme in der Trinkwasserinstallation. Sie können dann auftreten, wenn die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) nicht beachtet werden. Pseudomonaden kommen vorwiegend nur in kaltem Wasser vor und sind hauptverantwortlich für die Entstehung von Biofilmen. In den Biofilmen wasserführender Systeme kann sich P. aeruginosa über Jahre aufhalten und zu systemischen Kontaminationen der Trinkwasserinstallation führen.
In neuverlegten Rohrleitungen kann P. aeruginosa nach externer Kontamination ebenfalls nachgewiesen werden. Sie zeichnen sich durch äußerst geringe Nährstoffansprüche und Vermehrungsfähigkeit schon bei Temperaturen unterhalb von 15 °C aus. Sie können prinzipiell alle Wässer einschließlich Trinkwasser kalt besiedeln. Pseudomonas aeruginosa gelangt entweder über die Hausanschlussleitung in ein Hausinstallationssystem oder wird bei Arbeiten an der Installation bzw. bei der Neuinstallation durch kontaminierte Bauteile oder Werkzeuge und Arbeitsmaterial eingebracht. Totleitungen und Stagnationen in der Hausinstallation fördern die Vermehrung. Auch Wachstum in Vorlagebehältern zur Trinkwasseraufbereitung (z. B. Enthärtung, Desinfektion) ist möglich – ebenso wie eine retrograde Kontamination (Rückverkeimung).
Betroffen sind insbesondere Kaltwasserleitungssysteme inklusive deren Entnahmestellen. Bei einer orientierenden Untersuchung reicht es deshalb aus, sie am Hauseingang und an der letzten Kaltwasserzapfstelle zu untersuchen.
Für Pseudomonas aeruginosa legt die TrinkwV keinen Grenzwert fest. Pseudomonas aeruginosa können u. a. Lungenentzündungen mit schwerem Verlauf, Wundinfektionen, Blutvergiftungen sowie Augen- und Ohrentzündungen hervorrufen und haben daher eine hohe Bedeutung in medizinischen Einrichtungen. So darf dieser beispielsweise in Gebäuden mit medizinischen Einrichtungen in 100 ml nicht nachweisbar sein.
Definition Indikatorparameter
Aufgrund der hohen Anzahl verschiedener möglicher Krankheitserreger kann das Trinkwasser in der regelmäßigen Routineüberwachung nicht auf jeden einzelnen Krankheitserreger untersucht werden, sondern es wird das Indikatoprinzip angewendet.
Abgeleitet aus dem Lateinischen indicare „anzeigen“ ist es ein Merkmal, das als Anzeichen für eine bestimmte Entwicklung, einen eingetretenen Zustand oder Ähnlichem dient.
Beispiele sind:
- Technischer Maßnahmenwert:
Bei Erreichen liegen vermeidbare Umstände vor, die eine Besorgnis der Gesundheitsgefährdung oder gar eine Gesundheitsgefährdung erwarten lassen. - Grenzwert:
Bei Nachweis des Krankheitserregers ist eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit zu besorgen. - Oder es werden Indikatorparameter untersucht, die auf Verunreinigungen des Wassers durch Fäkalien und damit fäkal ausgeschiedene Krankheitserreger von Mensch oder Tier hindeuten.
Diese Vorgaben sind für Sie relevant:



